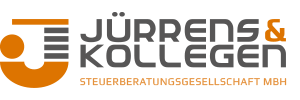Das Bundesfinanzministerium (BMF)
hat am 10.10.2019 den Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung des
Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht“ veröffentlicht.
Hintergrund: Deutschland
hat sich gemeinsam mit weiteren europäischen Ländern auf ein Verfahren
geeinigt, in Europa den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 40 %
gegenüber 1990 zu verringern. Dazu wurden verbindliche europäische Ziele sowie
daraus abgeleitet nationale Ziele vereinbart, die bis 2030 erreicht werden
müssen. Mit dem „Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im
Steuerrecht“ sollen wichtige Anpassungen unternommen werden, um die
Herausforderung der CO2-Reduktion bis 2030 entschlossen und gleichzeitig sozial
ausgewogen anzugehen. Umweltfreundliches Verhalten wird dadurch steuerlich
stärker gefördert. Dabei soll durch begleitende Regelungen erreicht werden,
dass alle Bürgerinnen und Bürger diesen Veränderungsprozess mitgehen
können.
Wesentlicher
Inhalt des geplanten Gesetzes:
Energetische Sanierungsmaßnahmen an
selbstgenutztem Wohneigentum sollen ab 2020 für einen befristeten Zeitraum von
10 Jahren durch einen prozentualen Abzug der Aufwendungen von der Steuerschuld
gefördert werden. Förderfähig sind Einzelmaßnahmen, die auch
von der KfW als förderfähig eingestuft sind, wie z.B.
-
Wärmedämmung von Wänden,
Dachflächen oder Geschossdecken, -
Erneuerung der Fenster oder
Außentüren, -
Erneuerung bzw. der Einbau
einer Lüftungsanlage, -
Erneuerung einer
Heizungsanlage, -
Einbau von digitalen Systemen
zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und -
die Optimierung bestehender
Heizungsanlagen
mit 20 % der Aufwendungen, maximal
insgesamt 20.000 € je Objekt (über drei Jahre verteilt) von der
Steuerschuld abziehbar.
Die konkreten Mindestanforderungen
sollen in einer gesonderten Rechtverordnung festgelegt werden, um zu
gewährleisten, dass die steuerlichen Anforderungen der noch zu konzipierenden
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) entsprechen.
Zur Entlastung von Pendlern soll –
befristet vom 1.1.2021 bis zum
31.12.2026 – die
Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer um 5 Cent auf 35
Cent angehoben werden. Die befristete Anhebung soll
entsprechend auch auf Familienheimfahrten im Rahmen der doppelten
Haushaltsführung übertragen werden.
Zudem soll Pendlern, die mit ihrem
zvE innerhalb des Grundfreibetrags liegen, die Möglichkeit eingeräumt werden,
alternativ zu den erhöhten
Entfernungspauschalen von 35 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer eine
Mobilitätsprämie in Höhe von 14 % dieser erhöhten Pauschale zu
wählen. 14 % entspricht dem Eingangssteuersatz im
Einkommensteuertarif. Hierdurch sollen auch diejenigen Bürger entlastet werden,
bei denen ein höherer Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug zu keiner
entsprechenden steuerlichen Entlastung führt. In die Bemessungsgrundlage der
Mobilitätsprämie werden die vollen 35 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer
einbezogen und nicht nur der aktuelle Erhöhungsbetrag von 5 Cent. Damit sollen
diese Geringverdiener spürbar entlastet werden. Sie werden den Pendlern
gleichgestellt, die mit ihrem zvE oberhalb des Grundfreibetrags liegen. Eine
Begünstigung ergibt sich für Arbeitnehmer sowohl bei den Werbungskosten als
auch bei der Mobilitätsprämie allerdings nur, soweit sich die 35 Cent ab dem
21. Entfernungskilometer wegen Überschreitens des Arbeitnehmer-Pauschbetrags
auch steuermindernd auswirken bzw. ausgewirkt hätten.
Zur Umsetzung des Ziels, die
Attraktivität des öffentlichen
Personenschienenbahnfernverkehrs zu verbessern, soll der
Umsatzsteuersatz für diese Leistungen von 19 auf 7 %
gesenkt werden.
Bisher können die Gemeinden bei der
Grundsteuer zwei verschiedene Hebesätze festlegen, die einheitlich für die in
der Gemeinde befindlichen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft einerseits und
für die Grundstücke andererseits sein müssen. Mit dem Gesetz soll den Gemeinden
ermöglicht werden, einen besonderen Hebesatz auf Sondergebiete
für Windenergieanlagen festzulegen. Dieser muss höher sein
als der jeweilige Hebesatz für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen
beziehungsweise das Grundvermögen.
Hinweis: Das Gesetz muss
noch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden.
BMF online, NWB